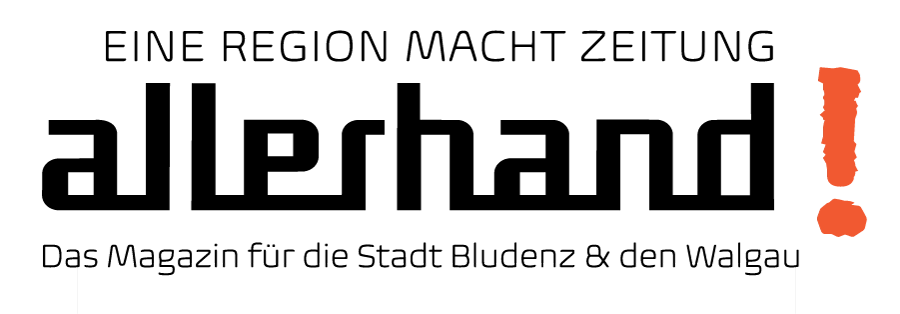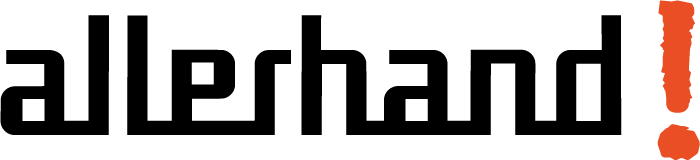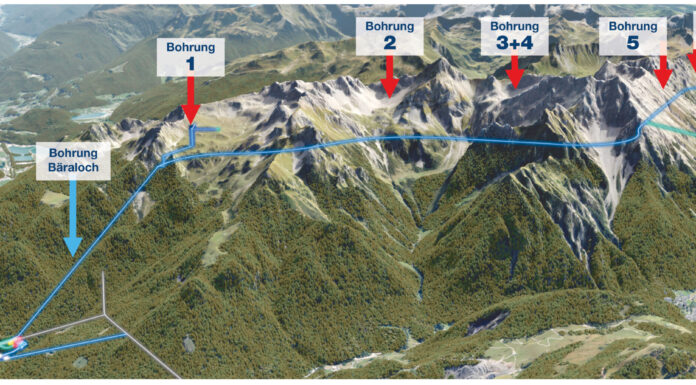Feuerlibellen haben in den letzten Jahrzehnten die Tümpel und Seen in unseren Breiten als Lebensraum für sich entdeckt. Sie gelten als Profiteure des Klimawandels.
FOTOS: GERALD SUTTER
„Ich war regelrecht überwältigt von diesem Farberlebnis“, erinnert sich Mag. Paul Amann an den Augenblick, als er zum ersten Mal eine Feuerlibelle durchs Fernglas betrachtete. Das ist zirka zwanzig Jahre her. Bis in die 1980er kannte man das ursprünglich aus Südafrika eingewanderte Insekt in Österreich eigentlich nur aus den Praterauen in Wien. Offensichtlich behagten dem roten Flitzer die warmen, trockenen Sommer der pannonischen Ebene, und der Klimawandel hat es wohl mit sich gebracht, dass sich diese Art inzwischen in ganz Österreich heimisch fühlt.

„In Vorarlberg sind mehr als dreißig Vorkommen bekannt“, weiß Libellen-Liebhaber Amann. „Es gibt sogar Brutnachweise.“ Denn während diese Libellenart früher lediglich zur „Sommerfrische“ von Südeuropa einflog, verbringt sie nun ihr ganzes, kurzes Leben in der Region. Wer die gut vier Zentimeter langen Flugkünstler beobachten möchte, schaut sich am besten im Uferbereich von flachen, sich schnell aufwärmenden Gewässern in Höhenlagen von 300 bis 600 Metern nach ihnen um. An den Baggerlöchern in Satteins oder in den Tümpeln im Bereich des Alten Rheins etwa stehen die Chancen gut.
Allerdings sollte man nicht aufgeben, wenn man anstatt der feuerroten, deutlich dezenter gefärbte Libellen erspäht. Denn die weiblichen Insekten sehen ihren männlichen Artgenossen alles andere als ähnlich. Auch sie schillern im Sonnenlicht, allerdings in zurückhaltenden Braun- und Orangetönen.
Kurzes Libellen-Leben
Das Erwachsenen-Leben einer Feuerlibelle dauert nur rund einen Monat. „Libellen haben keine innere Heizung“, erklärt Paul Amann. Sie sterben, sobald die Temperaturen fallen. Da die Larven sich aber nicht alle zur selben Zeit in geflügelte Insekten verwandeln – die Schlupfzeit erstreckt sich von Mitte Mai bis Juli – sind Feuerlibellen bis Mitte Oktober zu erspähen. Das Alter ist ihnen dann allerdings anzusehen. „Ihre Farben verblassen, sie fliegen weniger zackig“, hat Paul Amann beobachtet.
In unseren Breiten überwintern nur zwei Libellen-Arten als geflügelte Insekten, alle anderen müssen ihr kurzes Erwachsenenleben besonders gut nutzen. Oberstes Ziel ist der Erhalt der Art. Bei Feuerlibellen geht das nicht immer friedlich vonstatten. „Es ist auffallend, wie aggressiv die Männchen sich verhalten, wenn sich ein Weibchen in der Nähe befindet.“ – Paul Amann hat schon öfter gesehen, dass das Weibchen richtiggehend daran gehindert wurde, die vom Nebenbuhler befruchteten Eier am Gewässerrand abzulegen, und dann verschwand, während die Männchen sich weiterhin in der Luft Kopf an Kopf gegenüber standen und die Hinterleibe bedrohlich nach oben bogen.
Wenn hingegen alles glatt läuft, lässt das weibliche Tier die Eier, sobald es sich aus dem Paarungsrad gelöst hat, ins seichte Wasser fallen. Das Männchen beobachtet diese Prozedur aufmerksam, bewacht die Gefährtin und verscheucht die Rivalen.
Viele Monate am Grund eines Gewässers
Die Larven, welche schon nach wenigen Wochen aus den Eiern schlüpfen, verbringen hierzulande rund ein Jahr am Grund des Gewässers. In wärmeren Regionen entwickeln sie sich innerhalb von neun bis zehn Wochen, sodass dort in einem Sommer zwei Generationen an Feuerlibellen zu beobachten sind.
Anfangs sind die frisch geschlüpften Larven noch bewegungsunfähig. Doch schon nach der ersten Häutung, die bereits wenige Sekunden später erfolgt, sind sie mit sechs Beinen ausgestattet, die mit kräftigen Dornen bestückt sind. Derart gerüstet machen sie sich auf die Jagd nach Mückenlarven, Wasserflöhen, Kaulquappen, kleinen Krebsen und sogar Fischen. Mit ihrer zur Fangmaske umgebildeten Unterlippe können sie blitzschnell zuschlagen. Wenn die Beute sich nahe genug befindet, schnellt die Fangmaske innerhalb von Sekundenbruchteilen nach vorne, um sie mit den zwei vorderen, beweglichen Zähnen zu ergreifen.
Im Laufe ihrer Entwicklung zum erwachsenen Tier häuten sich die Larven zirka zwölf Mal. Für die letzte Häutung steigen sie dann aus dem Wasser. Sie klammern sich an einen Halm und trennen sich von den großen Kiemenblättern, durch welche die Larve unter Wasser geatmet hat. Nach dem Schlupf holt die fertige Libelle durch vier Löcher am Körper Luft. Erst nach rund 15 Minuten ist der Leib soweit ausgehärtet, dass die Libelle sich ganz aus ihrer Larvenhaut lösen kann. Während sie Flüssigkeit in ihren Körper pumpt und sich die Flügel langsam entfalten, krallt sie sich an ihrer alten Haut fest. Sie darf keinesfalls loslassen, weil sie sonst ins Wasser stürzen und ertrinken würde. In dieser Phase ist sie ein leichtes Opfer für Feinde wie etwa Vögel, Frösche, Fledermäuse oder Spinnen. Zieht in dieser Zeit ein Gewitter auf, sind die Tiere meist ebenfalls dem Tod geweiht. Erst nach rund einer Stunde sind die jungen Libellen in der Lage, sich zum Jungfernflug zu erheben.
Geschickte Jäger
Weil Libellen die beiden Flügelpaare unabhängig voneinander bewegen können, sind sie unberechenbare Flieger. Sie wechseln die Flugrichtung abrupt, Insekten aller Art erbeuten sie während des Flugs. Sie bilden dazu mit den Beinen eine Art Korb, mit dem sie die Beute einfangen und dann zu den Mundwerkzeugen führen.

Als Lebensraum benötigen Feuerlibellen – wie auch die meisten anderen Libellenarten – ein Gewässer mit dichtem Uferbewuchs und offenen Flächen, das den Larven Nahrung sowie geeignete Verstecke und den geflügelten Tieren Jagdraum bietet. Gewässer in sonniger Lage mit Wasserpflanzen, Unterwasservegetation, einem breiten Schilfgürtel, ohne allzu viele Fische, die den Larven gefährlich werden können, werden von den unterschiedlichsten Libellen-Arten gerne besucht. Das Jagdgebiet der erwachsenen Tiere erstreckt sich aber über ein weit größeres Gebiet mit insektenreichen Wiesen und Gehölzen. Weil sie in Bezug auf ihre Nahrung wenig wählerisch sind und im Laufe ihres nur rund einen Monat dauernden Erwachsenen-Lebens bis zu tausend Kilometer zurücklegen können, werden sich Feuerlibellen in den nächsten Jahren hierzulande weitere Territorien, wahrscheinlich auch in höheren Lagen, erobern. „Es ist zu erwarten, dass die Feuerlibelle bei uns noch häufiger wird“, lädt Biologe Paul Amann zum Beobachten dieser faszinierenden Art ein.
In diesem Buch über die in Liechtenstein vorkommenden Libellen, an dem der Schlinser Biologe, Mag. Paul Amann, federführend mitgearbeitet hat, sind rund 90 Prozent jener Arten beschrieben, die auch in Vorarlberg heimisch sind. Es ist beim Amt für Umwelt in Vaduz beziehungsweise mit der ISBN 978-3-9523234-9-6 im Buchhandel erhältlich.

Feuerlibelle
(Crocothemis erythraea)
Feuerlibellen werden dreieinhalb bis viereinhalb Zentimeter lang. Ihre Flügelspannweite beträgt rund sechseinhalb Zentimeter. Sie gehören zu den Großlibellen. Die Art kommt ursprünglich aus dem südlichen Afrika. Die ausgezeichneten Flieger – sie können in ihrem nur gut vier Wochen langen Leben bis zu tausend Kilometer zurücklegen – wagen sich seit etwa zwanzig Jahren immer weiter in den Norden vor. Die Feuerlibelle gilt sogar schon in Teilen Dänemarks als heimisch. In vielen Regionen Vorderasiens ist sie ebenfalls weit verbreitet. Das Männchen ist von Kopf bis Fuß signalrot, das Weibchen weniger auffällig gefärbt.