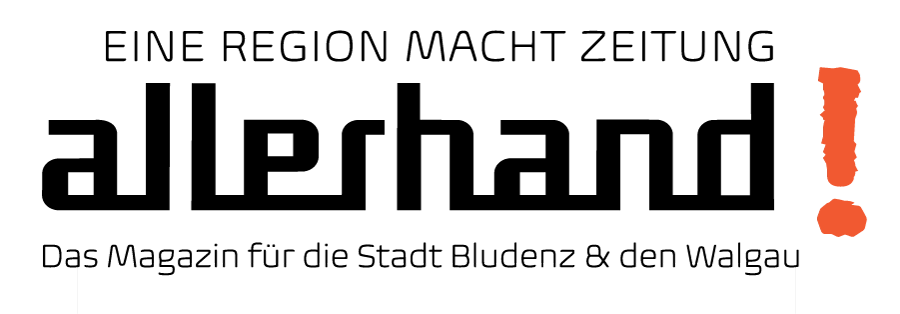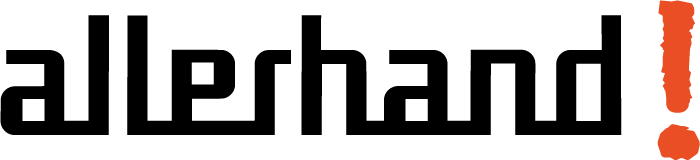Am 4. Mai 1945 beendeten französische Soldaten die Herrschaft der Nazis in Bludenz. Die Stadt hatte 357 Gefallene und 44 Vermisste zu beklagen. Während der toten Soldaten fast überall zumindest mit Kriegerdenkmälern gedacht wird, bleiben die zivilen Opfer oft im Dunkeln. Stadtarchivar Mag. Christof Thöny nimmt den 75. Jahrestag nun zum Anlass, genau diesen Schicksalen nachzuspüren. Im August will er mit einer Ausstellung zur Auseinandersetzung anregen.
FOTOS: STADTARCHIV BLUDENZ, PRIVAT, TM-HECHENBERGER
„Dies soll anhand konkreter Biografien geschehen”, erklärt Christoph Thöny. Er hat dafür in den Archiven recherchiert, aber auch die Nachkommen der NS-Opfer befragt. Das reißt oft alte Wunden auf. Hannah Slote beispielsweise möchte nicht an diese Zeit erinnert werden. Sie gehörte der einzigen jüdischen Familie an, die damals in Bludenz lebte. Die Nationalsozialisten haben das Geschäft ihres Vaters Julius Iger in der Wichnerstraße zwangsweise geschlossen und an einen „Arier” weitergegeben. Über Wien konnte die Familie nach Amerika fliehen. Hannah Slote lebt heute in New York.

WIDER DAS VERGESSEN
„Menschen, die in dieser Zeit Mut bewiesen haben oder aufgrund der NS-Ideologie verfolgt wurden, sollen nicht in Vergessenheit geraten und in die Erinnerungskultur miteinbezogen werden.”
Mag. Christof Thöny,
Stadtarchivar
Keinerlei Erinnerungen an ihren Vater hat hingegen Helga Thönig. Sie war gerade einmal dreieinhalb Jahre alt, als ihr Vater Alois Jeller am 3. Mai 1945 von den Nazis ermordet wurde. Was damals genau geschah, wissen sie und ihre fünf Jahre ältere Schwester Margit Bertl bis heute nicht. Fakt ist, dass der Widerstandskämpfer mit eingeschlagenem Schädel und einer Kugel im Kopf im Keller der Kreisleitung der NSDAP in der Untersteinstraße aufgefunden wurde. Historiker gehen davon aus, dass die Widerstandsbewegung die NSDAP-Kreisleitung in den letzten Kriegstagen dazu bewegen wollte, auf eine Verteidigung der Stadt zu verzichten. Während Jellers Begleiter flüchten konnten, wurde dieser aufgespürt, gefoltert und getötet. „Mama ist ihr Leben lang nicht darüber hinweggekommen, hat aber nicht viel darüber geredet”, erinnert sich Helga Thönig. Ein Kollege von der Widerstandsbewegung, von dem sich die Schwestern Aufklärung versprachen, vertröstete die Mädchen auf eine Zeit, wenn sie etwas älter wären. „Dazu ist es aber nie gekommen.”
Ihre Schwester Margit Bertl weiß, dass ihre Mutter am nächsten Tag beim Gauleiter vorgeladen wurde. Er habe ihr die persönlichen Sachen des Vaters mit den Worten „Sind sie froh, dass die Franzosen vor der Tür stehen, sonst wären sie und ihre Kinder auch noch drangekommen” überreicht. Diese Erinnerungen hat sie in einem Beitrag für das „Bludenz Lesebuch” von Dr. Manfred Tschaikner zusammengefasst. „Als die ersten Gefangenen nach Hause zurückkehrten, bin ich jedes Mal zum Bahnhof gelaufen, um nach meinem Vater Ausschau zu halten”, habe sie dessen Tod lange Zeit nicht akzeptieren können. Sie ist sich heute sicher, dass er denunziert wurde.
Historiker Meinrad Pichler hat das Schicksal eines anderen „unbequemen” Bludenzers beleuchtet: Der 1898 geborene Franz Josef Gstrein nahm als Hüttenwirt in der Kantine der Vorarlberger Illwerke kein Blatt vor den Mund. Dass er sich mehrfach abfällig über Hitler äußerte und den Führer gar einen Idioten nannte, führte zu einer Anzeige. „Weil man nicht so recht wusste, was man mit ihm tun sollte”, so Pichler, wurde er in die psychiatrische Heilanstalt Hall in Tirol eingeliefert und später in der Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart in Linz mit einer Giftspritze getötet.
Maria Frick hingegen erfuhr im Alter von 70 Jahren, dass ihre Mutter sehr wohl noch lebte. Nachdem sie als Pflegekind bis zum Alter von sechs Jahren immer wieder weitergereicht wurde und „zu fremden Menschen Mama und Däta sagen musste”, wuchs sie in Raggal Plazera auf. Erst als sie für ihre bevorstehende Hochzeit mit Werner Frick Papiere benötigte, erfuhr sie den Namen ihrer Mutter. Oleana, eine Zwangsarbeiterin aus der Ukraine, hatte ihr Kind 1944 in einem Auffanglager in Hohenems geboren. Sie war damals gerade einmal knapp 16 Jahre alt.
Weil jeder ihr versichert hatte, dass ihre Mutter tot sei, beschäftigte sich Maria Frick lange Zeit nicht weiter mit ihrer Herkunft. Vor sechs Jahren entdeckte sie in der Zeitung allerdings die Ankündigung einer Buchpräsentation: Eine Historikerin hatte ein Buch über das Schicksal ukrainischer Zwangsarbeiter geschrieben. „Da gehe ich hin”, beschloss sie kurzerhand zum Erstaunen ihrer Töchter. Bei der Veranstaltung im Theater Cosmos in Bregenz fügte es sich, dass sie neben einer Russischlehrerin zu sitzen und ins Gespräch kam. Als diese erfuhr, was die Bludenzerin zur Buchpräsentation geführt hatte, stellte diese sofort aufgeregt den Kontakt zur Buchautorin, Historikerin Dr. Margarethe Ruff, her. Diese machte sich Notizen und wollte mit Maria Frick in Kontakt bleiben. „Ich dachte mir, hi isch nüt”, lacht die Bludenzerin. Denn heute ist sie unendlich dankbar für alles, was danach geschah. Mit ihrem Einverständnis forschte die Historikerin weiter und aktivierte den „Deutschen Suchdienst”, der dann prompt ans Licht brachte, dass Maria Fricks Mutter noch lebt. „Ich war völlig durcheinander”, schildert Maria Frick ihre Empfindungen und wusste sofort: „Ich muss sie treffen.” Von da an schwamm die Bludenzerin auf einer Glückssträhne dahin, eines fügte sich zum anderen. Ein paar Briefe gingen hin und her, die auf beiden Seiten erst übersetzt werden mussten. Schwägerin Susanne bot sich als Begleitung an. Deren Nachbar bat seinen Bruder, seine geschäftlichen Kontakte in die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Firmen-Chauffeur und Dolmetscherin standen bereit, als Maria Frick und ihre Schwägerin in Kiew landeten. „Danach ging es drei, vier Stunden in die Pampa, und ich habe nur geschaut.” Am Ziel wurden die beiden Frauen von einer großen Schar Verwandter empfangen. Onkel, Tanten, Neffen, Nichten, Cousinen und Cousins standen Spalier und überreichten den Gästen aus Österreich eine Ukrainische Hochzeitstorte. Eine kleine Frau mit einem Stecken ging auf Maria Frick zu. „Alle haben geweint, nur wir beide nicht, keine einzige Träne”, berichtet die Bludenzerin. Sie war anfangs erschüttert über die ärmlichen Verhältnisse, in der ihre Verwandten lebten. Doch nach einem weiteren Besuch kann sie sich heute gut vorstellen, in der Heimat ihrer Mutter zu leben. Die Bludenzerin schätzt die Herzlichkeit und Naturverbundenheit ihrer fernen Verwandtschaft.
Sie weiß jetzt, dass ihre Mutter kurz nach der Niederkunft Nachricht erhielt, sie solle in einen Zug steigen, dann komme sie nach Hause. Sie musste sich von einer Minute auf die andere entscheiden und hatte Heimweh. Schließlich war sie ja nicht freiwillig in Vorarlberg und wurde hier als Mensch zweiter Klasse behandelt und ausgebeutet. Den Säugling konnte die junge Mutter allerdings nicht mitnehmen und ließ das Kind deshalb bei Bekannten zurück. Glücklicherweise landete die Ukrainerin auch tatsächlich in der Heimat, musste sich dort aber über Monate verstecken, weil sie ein Kind vom Feind geboren und dieses noch dazu im Stich gelassen hatte. Die heute 93-Jährige hat nie geheiratet und keine weiteren Kinder.
Es sind Geschichten wie diese, mit denen Stadtarchivar Christof Thöny aufzeigen möchte, was damals geschah und wie sehr die Menschen ihrem Schicksal ausgeliefert waren.
Am 20. August um 18 Uhr wird die Ausstellung „Widerstand und Verfolgung in Bludenz in der NS-Zeit” in der Galerie allerart eröffnet.