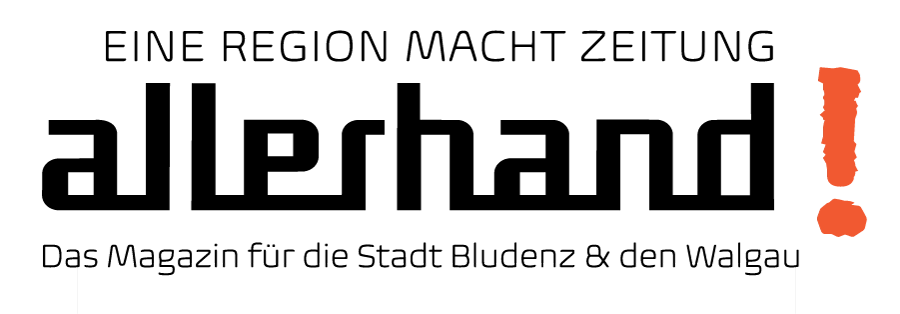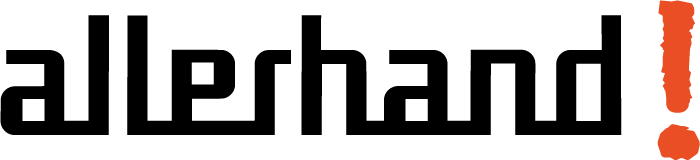Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am 4. April dieses Jahres der Baubeginn für das Hochwasser-Schutzprojekt „Montjola” in Thüringen gefeiert. Es ist im Walgau eines der letzten von unzähligen Projekten, für die Bund, Land und Gemeinden seit dem Pfingsthochwasser 1999 und jenem im August 2005 landesweit bereits über 300 Millionen Euro investiert haben.
FOTOS: FW THÜRINGEN, FFW FRASTANZ, M+G INGENIEURE, WASSERVERBAND ILL-WALGAU, PRIVAT, TM-HECHENBERGER
„Einen hundertprozentigen Schutz wird es nie geben”, stellt Ing. Martin Netzer klar. Seit 40 Jahren arbeitet er für das Land in der Abteilung Wasserwirtschaft und kennt die fast unzähligen fertiggestellten, in Bau und Planung befindlichen Schutzprojekte vor allem an der Ill und ihren Zuflüssen bis ins Detail. So groß die Anstrengungen und Investitionen auch sind – ein Restrisiko werde immer bleiben, betont er bei jeder Gelegenheit.
Ein Blick zurück in die Geschichte, wie sie in der Broschüre „Hundert Jahre Hochwasserschutz in Nenzing” von Gemeindearchivar Thomas Gamon und Herbert Rösler aufbereitet wurde, ist dabei hilfreich:
Der Walgau war über Jahrhunderte immer wieder von Überschwemmungen betroffen. Unsere Vorfahren kannten die Gefahren und hielten mit Häusern und Höfen immer einen Mindestabstand zur Ill und anderen Gewässern ein. Bevölkerungswachstum und die aufkommende Industrie, die sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts der Wasserkraft bediente, brachte die Menschen allmählich näher an die Bäche und Flüsse heran.
Im Juni des Jahres 1910 tobten nach einem schneereichen Winter bei Schneeschmelze, nassen Böden und Dauerregen die Gewässer im ganzen Land. „Mehrere Tage dauerte dieses Wüten, dem die Menschen fast ohnmächtig gegenüberstanden”, schrieb dazu Oskar Wiederin im Heimatbuch „Seinerzeit in Frastanz”. Die Schäden des Hochwassers von 1910, dem auch zahlreiche Menschen zum Opfer fielen, waren gewaltig. „Ein Gutes hatte das Hochwasser aber doch”, fasste Wiederin zusammen. „Jetzt endlich wurden die Gelder für eine umfassende Verbauung der heimischen Wasserläufe freigemacht, nachdem man sich jahrhundertelang mit Flickwerk beholfen hatte.”
Tatsächlich wurden die Ill und zahlreiche Zuflüsse in der Folge dem damaligen Kenntnisstand entsprechend technisch gesichert: Vor allem mit hohen Dämmen und Sohlschwellen. Die Gewässer wurden regelrecht „kanalisiert”. Diese Maßnahmen „wirkten” im mehrfachen Sinn. Einerseits blieb man entlang der Ill über Jahrzehnte von Überschwemmungen verschont. Diese vermeintliche Sicherheit führte aber andererseits zu einer nahezu hemmungslosen Besiedelung von gewässernahen Gebieten, die für unsere Vorfahren noch tabu waren.
Über die tausende neuen Gebäudedächer, versiegelten (Park-)Plätze und Straßen kann Regenwasser nicht versickern, sondern fließt über die Kanalisation ohne Verzögerung direkt in die Gewässer. In den Jahren 1999 und zuletzt 2005 führten diese Faktoren im Zusammenspiel mit dem Aufeinandertreffen ungünstiger Wetterverhältnisse (anhaltender Starkregen, gefrorene bzw. durchnässte Böden gepaart mit Schneeschmelze) zu verheerenden Hochwasser-Ereignissen.
Wenn man – 25 Jahre nach dem 99er-Ereignis und analog zum Resümee von Oskar Wiederin das Hochwasser von 1910 betreffend – etwas Positives daraus ableiten will: Seither wurden von Bund, Land und Gemeinden gewaltige Summen für den Hochwasserschutz investiert. Und zwar nicht mit brachialen Verbauungen, sondern im Gegenteil, indem man bis dahin „einbetonierte” Gewässer wieder freilegte, Retentionsflächen schuf und die ökologische Situation verbesserte, wo dies möglich war.
Der hundertprozentige Schutz ist aber auch dann nicht gegeben, wenn die noch vorgesehenen und im aufwendigen Bewilligungsverfahren „steckenden” Projekte umgesetzt sind. Zumal sich die meisten Experten einig sind, dass der Klimawandel eine Häufung von außerordentlichen Wettersituationen mit sich bringen wird.
Montjola: Mikromining statt Riesenbaustelle
Das seit dem Spatenstich Anfang April in Bau befindliche Schutzprojekt „Montjola” in Thüringen ist Ergebnis jahrelanger Verhandlungen, Variantenuntersuchungen und guter Zusammenarbeit der Gemeinden Bludesch und Thüringen.
Schon bei einem lokalen Unwetter zu Weihnachten 1991 und dann bei Hochwasserereignissen 1999 und 2005 wurden in Thüringen und Bludesch unzählige Keller überflutet, es mussten Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden (2005 wurden 200 Personen vorübergehend in der Walgaukaserne untergebracht).
Einen guten Teil zu den Wassermassen trägt der Schwarzbach bei, der im Normalfall als harmloses Bächlein den Montjolaweiher speist. Das Einzugsgebiet dieses Schwarzbaches, in den auch das Wasser aus dem Schlosstobel geführt wird, ist mit zehn Quadratkilometern allerdings riesig. Wenn auf diese Fläche – wie 2005 geschehen – an einem Tag auf jedem dieser zehn Millionen Quadratmeter 125,5 Liter Regenwasser prasseln, ist das eine ziemliche Menge… Aus dem Montjola-Weiher wird dann ein See, der Schwarzbach stürzt mit gewaltiger Kraft über den Montjola-Wasserfall in die Tiefe und fließt (teilweise durch Betonröhren) bis nach Bludesch-Gais. Praktisch der ganzen Strecke entlang tritt er über die Ufer und flutet Keller und Straßen.


Künftig soll das „Überwasser” von der Montjola (Quadern) durch eine große Röhre über die Lutz abgeführt werden: Diese ist schon vor Jahren in einem vielbeachteten – und mit dem Neptunpreis für ökologischen Wasserbau ausgezeichneten – Projekt auf entsprechende Wassermassen vorbereitet. Die 700 Meter lange Röhre mit einem Durchmesser von 1,90 Metern wird auf Quadern (Montjola) aber nicht einfach eingegraben, was für die ökologisch wertvolle Ebene zerstörerische Erdbewegungen bedeutet hätte. Stattdessen wird sie in einem Tunnelbau-Spezialverfahren (Mikromining) quasi unterirdisch „eingeschoben”.
14 Millionen kostet allein dieses Projekt, mit dem aber Überflutungen in Thüringen und Bludesch samt Evakuierungsmaßnahmen der Vergangenheit angehören sollten. Der Spatenstich am 4. April war für die Bürgermeister Martin Konzet (Bludesch) und Thüringen (Harald Witwer) daher ein guter Anlass für eine kleine Feier.
Stabiles Ufer entlang der Autobahn
Wenige Kilometer von der Spatenstichfeier auf Quadern entfernt, räumte zur gleichen Zeit die Arbeitsgemeinschaft Tomaselli/Hilti&Jehle ihre Großbaustelle an der Ill: Zwei Jahre lang war dort – jeweils in den Niedrigwasserperioden von Oktober bis März – entlang der Autobahn auf Schlinser und Satteinser Ortsgebiet gearbeitet worden. Es ging dabei um nichts weniger als um die Sicherheit der Autobahn. Das rechte Illufer war nämlich infolge der Hochwasserereignisse instabil geworden und erodierte bei entsprechendem Wasserstand Richtung A14. Dieser Erosionsprozess wurde durch das Einbringen von großen Flussbausteinen mit einem Gesamtgewicht von rund 130.000 Tonnen gestoppt.

Auftraggeber für diese Maßnahme war der Wasserverband Ill-Walgau: Die Gründung dieses Verbandes kann aus heutiger Sicht ebenfalls als positive Folge der Hochwasserereignisse von 1999 und 2005 angesehen werden. Im Wasserverband arbeiten alle zwölf Ill-Anrainergemeinden von Bürs bis zur Rheinmündung in Meiningen zusammen. Das Land, die ASFINAG und die ÖBB sowie die Kraftwerksbetreiber Stadtwerke Feldkirch, Getzner Mutter & Cie GmbH & Co, illwerke vkw sowie die Spinnerei Feldkirch sind ebenfalls „mit im Boot”.

Geschäftsführer des
Wasserverbandes Ill-Walgau
Geschäftsführer DI Wolfgang Errath betont, dass es allen Beteiligten darum geht, parallel zu den Hochwasserschutzmaßnahmen auch immer die ökologische Situation entlang der Ill zu verbessern. So wurde die Ill bei Nüziders aufgeweitet und von zwei Sohlschwellen befreit: Diese Betonsperren waren in früheren Jahrzehnten eingebaut worden, um im Bereich größerer Gefälle die Fließgeschwindigkeit zu drosseln. Damit konnte zwar die Eintiefung des Bachbettes verhindert werden. Für viele Fische wurden die Schwellen aber auf ihrem Weg zu den Brutplätzen flussaufwärts und in den Seitengewässern zum unüberwindbaren Hindernis. Jetzt wurden diese Barrieren durch Sohlrampen ersetzt, welche von den Fischen leicht passiert werden können.
Die wichtigste Errungenschaft in Sachen Hochwasserschutz sind aber die Retentionsflächen, die in Ludesch, Nenzing, Bludesch und Göfis- Schildried (durch die Absiedlung von 16 mehrfach überfluteten Einfamilienhäusern) geschaffen bzw. gesichert wurden. Im Ernstfall kann der Ill-Wasserpegel durch Ableitung in diese Flächen gesenkt und damit (vielleicht) eine Überschwemmung der Dämme zumindest verzögert, mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar verhindert werden. Zumal dann, wenn eine große Retentionsfläche in Satteins dazukommt: Das wurde erst durch die grundsätzliche Zustimmung der Grundbesitzer vor wenigen Wochen möglich.

Über diese Einigung freute sich vielleicht niemand so sehr, wie der frühere Frastanzer Bürgermeister Eugen Gabriel: Damit kommt nämlich auch die Umsetzung des Hochwasserschutzprojektes im „Bauabschnitts 3” in den Bereich des Möglichen. Es geht dabei vor allem um eine Vorsorge für den Siedlungsraum „Sonnenheim” in Frastanz. Die Pläne dazu wurden seit dem Hochwasser 1999 geschmiedet, immer wieder beeinsprucht und abgeändert. Im Frühjahr 2005 waren sie endlich so weit gediehen, dass man zu einer öffentlichen Präsentation des Vorhabens laden konnte. Aber dann kam das Hochwasser…
Als sich Eugen Gabriel am Montag, 22. August 2005 wie üblich um 7 Uhr in der Früh zu seinem Arbeitsplatz im Frastanzer Rathaus aufmachte, regnete es zwar wie schon an den Tagen zuvor. Was auf ihn zukommen würde, war aber nicht zu erahnen: Ein „Jahrhunderthochwasser” hatte man schließlich erst sechs Jahre zuvor – im Jahr 1999 – erlebt.
Auch damals war Gabriel dabei gewesen, allerdings „nur” als Vizebürgermeister. In der neuen Funktion als Ortschef aber, der er seit 2004 war, musste er im Katastrophenfall formal als Einsatzleiter Verantwortung übernehmen. Vor Dienstschluss um 18 Uhr informierte sich Gabriel über die Lage. „Nicht besorgniserregend” lautete zu diesem Zeitpunkt die Auskunft des diensthabenden Feuerwehrkommandanten Martin Schmid.

Eine Stunde später aber ging der erste Notruf ein. Ihm folgten im Minutentakt weitere Meldungen: Keller überflutet, Bäche gehen über, Straßen sind unpassierbar. Das 2005er-Hochwasser sollte noch schlimmer werden als jenes von Pfingsten 1999. Damals brachte die Ill (bei Gisingen) bis zu 554 Kubikmeter in der Sekunde, sechs Jahre später waren es 689.000 Liter. Gabriel war im Dauereinsatz, schließlich standen laufend heikle Entscheidungen an, die immer in gemeinsamer Beratung mit dem Feuerwehrkommando und – nach einem klar geregelten Ablauf – teilweise mit übergeordneten Stellen gemeinsam getroffen wurden: Eine verklauste Engstelle zu öffnen, weil sie das Wasser gefährlich zurückstaute, bedeutete schließlich unter Umständen Schaden an anderer Stelle. Erst am Mittwoch um 23 Uhr, nach fast drei Tagen durchgehendem Einsatz, konnte er sich zum längst überfälligen Schlaf hinlegen.
Das Thema Hochwasserschutz bescherte ihm in den Jahren darauf aber noch viele schlaflose Nächte. Nach diesem Ereignis wurde der vorher mühsam ausgearbeitete Maßnahmenplan für Null und Nichtig erklärt. Die Schutzziele mussten neu definiert, die Planungen neu begonnen werden. „Solche Verfahren sind extrem nervenaufreibend und ab und zu könnte man die Wände hoch laufen, wenn wieder ein neuer Einspruch daherkommt”, berichtet Gabriel. Mit seinem energischen Engagement für die Zusammenarbeit aller Gemeinden hat er aber wesentlich zur Gründung des Wasserverbandes Ill-Walgau beigetragen. Und dieser wiederum ist bis heute die solidarische Grundlage für Lösungen, die alle, und oft divergierende, Interessen von betroffenen Grundeigentümern, Naturschützern, Technikern, Hausbesitzern und letztlich der ganzen Bevölkerung bestmöglich berücksichtigen.
Bange Stunden für Unternehmer

Georg Mündle ist 2005 mit einem blauen Auge davongekommen: Weil er aus den Erfahrungen als Feuerwehrmann seine Schlüsse gezogen hat. Der Sägewerksbesitzer hatte wenige Monate zuvor mit dem Neubau seines Betriebes in der Satteinser Au begonnen. Der Rohbau stand bereits und die ersten Maschinen waren vom alten Standort im Ortszentrum zum Neubau transportiert worden. Am Montag, 22. August 2005, hätten die Techniker und Elektriker kommen sollen, um diese Maschinen einzurichten und an den Strom anzuschließen. Stattdessen kam das Hochwasser. Als aktiver Feuerwehrmann hatte Mündle bei den Überflutungen 1999 miterlebt, wie der wildgewordene Sägenbach die Wiesen in der Unteren Au in einen See verwandelte. Er beschloss daher, den Neubau durch Verwendung des Aushubes entsprechend höher zu setzen. „Das Wasser kam vor die Tore, aber nicht in die Halle”, erinnert er sich daran, wie froh er war, die Mehrarbeit auf sich genommen zu haben. Den Schlamm wegzuräumen, den das Wasser zurückgelassen hatte, war zwar aufwändig – und die Maschinen konnten erst mit zwei Wochen Verspätung eingebaut werden, weil die Techniker bei Firmen zum Beispiel im Nenzinger Gewerbegebiet vorrangig eingesetzt wurden. Den dadurch bedingten zweiwöchigen Betriebsausfall nahm er ohne Groll zur Kenntnis. „Es gab ja viele, die es wirklich hart getroffen hat. Ich darf da überhaupt nicht jammern.”

Bernhard Geiger kann sich ebenfalls noch gut an bange Stunden erinnern. „Am Montagabend wurde ich zuhause in Gurtis informiert, dass die Ill stark ansteigt und möglicherweise bald über den Damm flutet”, berichtet der Chef der Geiger Technik GmbH im Betriebsgebiet von Nenzing. Er kontaktierte sofort seinen Werkstattleiter, und sie eilten gemeinsam zur Firma. Zusammen mit einigen Mitarbeitern wurden zunächst Sandsäcke vor die Tore gestapelt. Die Hoffnung, die Werkstätten auf diese Weise trocken halten zu können, erwies sich allerdings rasch als Trugschluss. „Das Wasser ist in einem Tempo angestiegen, das war unglaublich”, erinnert sich Geiger. Alles, was man tragen konnte, wurde deshalb irgendwie in den oberen Stock „geworfen”: Aber das war in der mit schweren Maschinen vollgestellten Werkstätte nicht allzu viel. „Einen Pritschenwagen hievten wir dann noch mit dem Hallenkran in die Höhe, wo er dann drei Tage lang hängen blieb, bis wir wieder Strom hatten. Immerhin hat er es überstanden”, so Geiger.
Nachdem nichts mehr zu retten war und das Wasser schon einen Meter hoch in der Betriebshalle stand, flüchtete Geiger in den ersten Stock, wo er das Flutgeschehen noch eine Weile beobachte. „Irgendwann bin ich dann durch das hüfthohe Wasser gewatet und nach Hause gefahren”, erinnert sich Geiger – heute mit einem Lächeln im Gesicht.
Als am übernächsten Tag das Wasser verschwunden war, machte man sich an das Aufräumen. „Die Feuerwehr, Familie, Freunde, Bekannte und die Mitarbeiter – alle haben geholfen”, erinnert er sehr positiv an diesen solidarischen Gewaltakt. Doch noch während diese Arbeiten im Gange waren, bekam Geiger Besuch von einem Rechtsanwalt.
Es ging um einen laufenden großen Auftrag, der schon zur Hälfte fertiggestellt, durch das Hochwasser aber unbrauchbar geworden war. Der Jurist in Gummistiefeln übergab ein Schreiben, das ihn an die zeitgerechte Lieferung des Auftrages erinnern sollte – und schockierte damit den gerade schwer gebeutelten Unternehmer ordentlich: „Für jeden Tag Verspätung wäre ich zur Zahlung von 55.000 Euro verpflichtet gewesen! Bei dieser Firma hat dann Landeshauptmann Herbert Sausgruber persönlich interveniert und mir so diese Strafzahlung erspart.” Das Land habe aber auch Mittel aus dem Katastrophenfonds bereitgestellt und rund die Hälfte des entstandenen Schadens in Millionenhöhe übernommen. „Dafür bin ich natürlich auch dankbar. Die andere Hälfte zu stemmen, war schwer genug”…
Schwerer Einsatz und unglaubliche Solidarität

Der heutige Bezirksfeuerwehrinspektor Karl-Heinz Beiter war damals als junger Feuerwehrmann dazu eingeteilt, gemeinsam mit seiner Truppe den Bereich unterhalb des Montjola-Wasserfalls zu sichern. Das war zunächst ein kleiner Schauplatz, das große Drama spielte sich im Bereich um das Gasthaus Blumenegg ab. Der Wasserfall brachte aber immer mehr Wasser, der Bach stieg an und erreichte bald die Höhe der Faschinastraße. Damit waren alle Häuser entlang und unterhalb der Straße akut gefährdet. Die Feuerwehrleute begannen also, das Wasser mit Sandsäcken abzuhalten.
„Es war schon nach Mitternacht, wir waren alle komplett durchnässt, und von zehn Sandsäcken, die wir auflegten, spülte es neun wieder weg”, schildert Beiter die Situation. Er befeuerte die Truppe, trotzdem nicht aufzugeben und mit den Sandsäcken weiterzumachen. Und das taten sie. Von zwanzig Säcken blieben zwei liegen, von dreißig drei und irgendwann begannen sie doch, ihren Dienst zu tun. Karl-Heinz Beiter nahm zu diesem Zeitpunkt aber auch die zunehmende Erschöpfung der Truppe wahr und erteilte zwei Männern den Auftrag, beim nächstgelegenen Haus nach Kaffee oder Tee zu fragen.
„Es war mitten in der Nacht und die um Hilfe gebetenen Nachbarn waren sofort bereit, die heißen Getränke zuzubereiten”, erinnert sich Beiter an die spontane Hilfsbereitschaft dieser Familie: Wie überhaupt während der ganzen Nacht viele „Zivile” die Feuerwehrleute an vielen Stellen unterstützten. Die wärmenden Getränke gaben den durchnässten Männern Kraft und Zuversicht. So wurden weiter Sandsäcke herbeigeschleppt und aufgelegt. „Immer mehr davon blieben liegen und so gelang es uns durch dauerndes Nachlegen, das tosende Wasser zurückzudrängen”, so Beiter.
Der besondere Einsatz der Truppe und die Führungsqualität des stellvertretenden Gruppenkommandanten Beiter wurden in der Nachbesprechung des Einsatzes besonders gewürdigt. Beiter wurde gefördert, durfte an einer umfassenden Schulung zum Thema Naturgefahren teilnehmen und qualifizierte sich bald für weitere Beförderungen. Im Jahr 2013 schließlich wurde er zum Kommandanten der Feuerwehr Thüringen gewählt und bewährte sich auch in dieser Funktion. Heute gehört Karl-Heinz Beiter als Bezirksfeuerwehrkommandant zur obersten Führungsebene. „Meine Karriere hat eigentlich damit angefangen, dass wir 2005 im vermeintlich aussichtslosen Kampf gegen die Fluten nicht aufgegeben, und dadurch letztlich doch gewonnen haben”, fasst Beiter zusammen. Und ergänzt: „Das haben in diesen schweren Tagen aber tausende Kameraden im ganzen Land ebenfalls getan!”