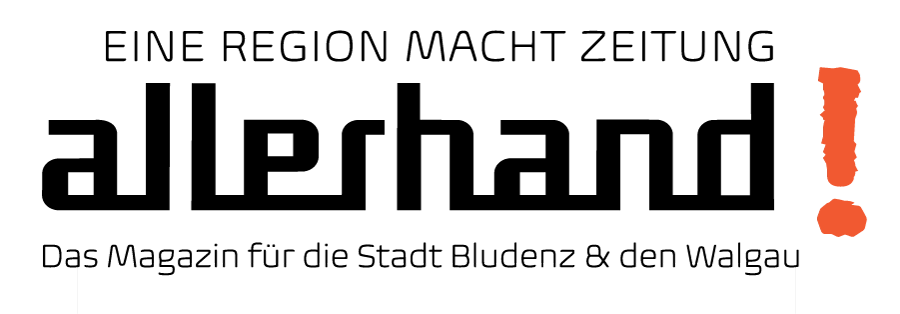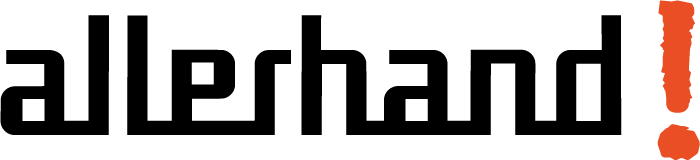Klimawandel, Drohnen und Freizeitsportler setzen diese typischen Bewohner unserer Berge zunehmend unter Stress. Das erschwert die Arbeit der Jäger, die sich um eine nachhaltige und waidgerechte Bejagung des Krickelwildes bemühen. Manuel Nardin kennt die Herausforderungen im Gamperdonatal.
FOTOS: MANUEL NARDIN, TM-HECHENBERGER
Gämsen gehören zu den Top-Athleten im Tierreich. Dank ihrer geteilten, spreizbaren Hufe finden sie in steilem Gelände sicheren Halt. Im Sprint erreichen diese Wildtiere Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h, sie können bis zu zwei Meter hoch und sechs Meter weit springen. Eine besonders hohe Anzahl an roten Blutkörperchen und ein großer Herzmuskel sorgen dafür, dass ihnen dabei die Puste nicht so schnell ausgeht.
In der rund 10.500 Hektar großen Wildregion Gamperdonatal, in der Manuel Nardin ein 2.800 Hektar großes Revier betreut, leben rund 600 Gämsen. Der Berufsjäger weiß dies ziemlich genau, weil der Wildbestand alljährlich im Oktober gezählt wird – und zwar gleichzeitig im Gamperdonatal sowie in den benachbarten Bergregionen in Liechtenstein und Brand. Schließlich halten sich die Tiere nicht an vom Menschen gezogene Revier- und Landesgrenzen. „Das Monitoring zeigt, dass der Bestand leicht abnimmt”, erklärt Manuel Nardin. Bei der Berechnung von Jagdquoten muss seit einigen Jahren der Luchs mitberücksichtigt werden, der über die Schweiz wieder im Gamperdonatal eingewandert ist. Neben dem Steinadler ist er der größte natürliche Feind der alpinen Kletterkünstler. Ein erwachsener Luchs braucht bis zu 50 Beutetiere von der Größe einer Gämse pro Jahr. Der Mensch übt auf den Bestand ebenfalls großen Einfluss aus – und zwar auf vielfältige Weise.
Nachhaltige Bejagung
55 bis 60 Tiere werden im Gamperdonatal alljährlich von Jägern erlegt. Das dichte Haarbüschel am Rücken männlicher Tiere – der Gamsbart – gilt traditionell als begehrter Hutschmuck, das Fleisch ist unter Feinschmeckern beliebt. „Der absolut größte Teil der Tiere wird aber in Waldgebieten mit Schutzfunktion erlegt”, betont Manuel Nardin, dass die Jäger damit dem Wildverbiss vorbeugen. Der größte Teil des von ihm betreuten Gebietes liegt oberhalb der Waldgrenze. Dort werden nur sehr wenige Tiere – und unter genau festgelegten Rahmenbedingungen – zum Abschuss freigegeben. Der Berufsjäger kümmert sich darum, dass niemand mitten in ein Rudel zielt und kein weibliches Tier erlegt wird, das noch sein Junges säugt, beziehungsweise keine erfahrene Geiß, die das Rudel anführt.
„Wir achten sehr darauf, dass das Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Tieren in den Gamsbeständen passt”, erklärt der gebürtige Bregenzerwälder. Er war schon in jungen Jahren mit dem Onkel auf der Jagd, hat das Leben der Wildtiere immer mit großem Interesse beobachtet. Er weiß, wie wichtig etwa gesunde Altersstrukturen mit einem hohen Anteil an älteren Böcken für den gesamten Bestand sind. Stimmt die Hierarchie unter den männlichen Tieren, verläuft die Brunft ruhiger und in kürzerer Zeit. Ist dies nicht der Fall, mischen sich im November zu junge Böcke in die Brunft-Zeremonien ein, die dafür noch nicht kräftig genug sind, und verausgaben sich dabei völlig. Folgt dann ein strenger Winter, kommt es zu hohen Ausfällen, weil die Fettreserven, welche die Tiere bei Verfolgungsjagden mit Artgenossen verloren haben, fehlen. „Während der dreiwöchigen Brunftzeit verlieren die Böcke bis zu einem Drittel ihres Gewichtes”, zeigt Manuel Nardin auf. Ein Missverhältnis zwischen männlichen und weiblichen Tieren kann unter Umständen zudem dazu führen, dass die Geißen zu spät befruchtet und die Jungtiere in der Folge zu spät geboren werden. Über den Sommer bleibt ihnen dann zu wenig Zeit, um sich die Reserven anzufressen, die sie benötigen, um den Winter gut zu überstehen. „Man muss all dies bedenken, wenn man eine Gams zur Jagd freigibt”, ist sich Manuel Nardin der Verantwortung bewusst. „Höchstens dreißig Prozent der alten Böcke dürfen vom Bestand entnommen werden, in Hochlagenrevieren nur alte Tiere, nahe an ihrer natürlichen Altersgrenze.”
Sechs Berufsjäger im Walgau
Zur Jagd freigegeben werden meist Tiere, die sich in Regionen aufhalten, wo sie im Winter Schaden anrichten könnten, wenn sie sich etwa an den Trieben der Bäume im sensiblen Schutzwald vergreifen, weil Gräser und Moose unter der Schneedecke nicht erreichbar sind. Ein verantwortungsbewusster Jäger zielt auf einzelne Tiere, die sich abseits des Rudels aufhalten. Er bemüht sich, die Wildtiere bei der Jagd so wenig wie möglich zu beunruhigen. Von Anfang Jänner bis Ende Juli ist Schonzeit.
Manuel Nardin ist froh darüber, dass sein Arbeitgeber ihm die Freiheit gibt, die Jagdgäste so genau zu instruieren. Mit dem Spektiv klärt er zuerst alle Details, bevor er grünes Licht für einen Abschuss gibt. Das Spezialfernglas verrät ihm etwa das Alter des Tieres oder, ob die Geiß noch ein Kitz führt. Ehrensache ist es, dass das erlegte Tier verwertet wird. „Selbst das Wildbret von alten Gämsen kann zu Spezialitäten wie Mostbröckle oder würzigen Kaminwurzen verarbeitet werden”, weiß der gelernte Metzger.
Diese Rahmenbedingungen für eine strukturangepasste Bejagung sicherzustellen, sieht Manuel Nardin als eine der wichtigsten Aufgaben, die er und seine fünf Berufskollegen sowie rund zwanzig nebenberufliche Jagdaufseher im Walgau zu erfüllen haben. „Mit sechs verhältnismäßig großen Jagdrevieren und Jagdpächtern, die sich einen Berufsjäger leisten, sind wir im Walgauer Rätikon recht gut aufgestellt”, zeigt sich Manuel Nardin zufrieden.
Beunruhigung der Wildtiere vermeiden
Zunehmend Sorgen macht er sich hingegen, wenn sich Freizeitsportler nicht an die ausgewiesenen Routen halten oder Drohnen für Stress im Gamsrudel sorgen. Die in Mode gekommenen, ferngesteuerten Fluggeräte werden von den Gämsen mit ihrem Erzfeind – dem Steinadler – verwechselt. Die Tiere geraten in Panik, wenn sie aus der Luft verfolgt werden. Paragleiter und Drachenflieger, die ihre Schatten über das äsende Wild werfen, aber auch Schitouren-Geher, die in Wintereinstände vordringen, verursachen denselben Aufruhr. Manuel Nardin hat schon oft beobachtet, wie ein Gamsrudel dann in Höchstgeschwindigkeit das Weite sucht und dabei dringend benötigte Kalorien verschwendet. Es kommt sogar vor, dass Tiere bei solchen Panikfluchten abstürzen. Nardin appelliert deshalb an Erholungssuchende, sich an die ausgewiesenen Wege zu halten und von Drohnenfotos abzusehen. Für Flugsportler gilt im Nenzinger Himmel aus gutem Grund ein Start- und Landeverbot. Das Mountainbiken ist nur auf ausgewiesenen Routen erlaubt.

„Es wäre wichtig, dass die Winterlebensräume der Wildtiere in den Wanderkarten eingezeichnet werden”, wünscht sich Manuel Nardin. Er ist überzeugt davon, dass niemand das Wild mutwillig gefährdet, hofft aber, dass sich die Erholungssuchenden etwas mehr bewusst werden, dass ihr Tun gravierende Folgen für andere Lebewesen hat. Naturfreunde, die das Wild in aller Ruhe beobachten möchten, machen dies am besten von den beschilderten Wanderwegen aus mit dem Fernglas oder Spektiv.
Der Mensch tut den Gämsen aber auch Gutes – indem er nämlich Rinder und Kühe im Sommer auf die Almwiesen treibt. „Dies führt dazu, dass die Hänge freibleiben und nicht verbuschen”, weiß Manuel Nardin um die Zusammenhänge. Lebensräume, welche die Gämsen für ihr Überleben brauchen, werden dadurch erhalten. „Das Wild steht im Herbst am liebsten da, wo im Sommer das Vieh grast”, beobachtet der Berufsjäger, der als Jugendlicher selbst einige Sommer auf einer Alpe gearbeitet hat. Er hofft deshalb, dass die Landwirte auch in Zukunft den Aufwand auf sich nehmen und ihre Tiere zur Sommerfrische schicken.
Herausforderung Klimawandel
Der Klimawandel wirkt sich ebenfalls auf den Gamsbestand aus. „Weil die Natur in den letzten Jahren immer früher aus der Winterruhe erwacht, sind die Bergkräuter im Frühsommer – der Hauptsäugezeit der Jungtiere – nicht mehr so eiweißreich und nahrhaft”, erklärt Manuel Nardin. Dadurch produzieren die Geißen weniger Milch. Weil diese weniger nahrhaft ist, legen die Kitze langsamer an Gewicht zu. Wenn der Sommer besonders heiß ist, suchen die Tiere zudem vermehrt den Schatten. Dadurch bleibt ihnen nicht so viel Zeit für die Nahrungsaufnahme, sie fressen sich in der Folge nicht genügend Fettreserven an, um in der kalten Jahreszeit davon zu zehren. Manuel Nardin hofft, dass die Tiere langfristig einen Weg finden, um sich den steigenden Temperaturen anzupassen.
November ist Brunftzeit
Im November versuchen die älteren Böcke, die Geißen damit zu beeindrucken, dass sie die Barthaare am Rücken aufstellen. Mögliche Konkurrenten werden in halsbrecherischen Verfolgungsjagden vom Harem ferngehalten. Zeigt das Imponiergehabe Erfolg, bringt die Geiß im Mai in der Regel nur ein Junges zur Welt. Sie ist zu diesem Zeitpunkt meist schon mindestens vier Jahre, maximal 15 Jahre alt.
Außerhalb der Paarungszeit geht der Bock einzelgängerisch eigene Wege, während sich die weiblichen Tiere im Rudel gemeinsam um den Nachwuchs kümmern. Das Kitz wird rund sechs Monate lang von der Mutter gesäugt, bleibt aber insgesamt ein Jahr an ihrer Seite. Das Jungtier folgt ihr bereits kurz nach der Geburt im steilen Gelände überall hin. Das Rudel wird von einer erfahrenen Leitgeiß angeführt, welche die besten Äsungsplätze und sichere Verstecke kennt, gefährliche Lawinenhänge hingegen meidet. In der Regel passt eine Geiß auf, während sich der Rest des Rudels den Bauch voll schlägt. Sobald Gefahr droht, pfeift die Wächterin, um die anderen zu warnen. „Dann flüchten die Kitze zur eigenen Mutter”, erklärt Manuel Nardin. „Der Kindergarten ist gut organisiert.” Bis zu 70 Tiere leben auf diese Art zusammen. Je offener das Gelände ist, umso größere Rudel werden gebildet. Während Steinböcke nur im Hochgebirge zuhause sind, kommen Gämsen durchaus auch in Höhenlagen von 400 bis 500 Metern vor. Es braucht allerdings steile, von Felsbändern durchzogene Lagen.

Im Winter auf Sparflamme
Im Sommer halten sie sich eher an kühlen Schattenhängen mit genügend Nischen zum Verstecken auf. In der kalten Jahreszeit bevorzugen sie hingegen sonnige, steile Hänge, an denen der Schnee schnell abrutscht, sowie Felskuppen, an denen der Wind dafür sorgt, dass die Natur das spärliche Grün freigibt. „Gämsen werden im Winter in der Regel nicht gefüttert”, erklärt Manuel Nardin. Umso wichtiger ist es, dass sie in der kalten Jahreszeit nicht gestört werden.
Im Winter ist das Fell der Gämsen fast schwarz. Das hilft den Tieren, die Wärme der Wintersonne zu speichern. Sie sonnen sich dann regelrecht an exponierten Stellen. Während Hirsch und Rehbock ihre Geweihe regelmäßig abwerfen, wachsen die Hörner von Gämsen ein Leben lang mit. An den sogenannten Krucken bilden sich gut erkennbare Jahresringe, an denen sich das Alter der Tiere leicht ablesen lässt.
Aktuell leben in fast allen Gebirgszügen Europas und im Kaukasus Gämsen. Auf den anderen Kontinenten kommt diese Wildart nicht vor. Einzige Ausnahme ist Neuseeland, wo Gämsen vor rund hundert Jahren ausgewildert wurden. „Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, diese typische Charakter-Wildart unserer Heimat für nachkommende Generationen zu erhalten”, appelliert Berufsjäger Manuel Nardin.
 Gämsen (Rupicapra rupicapra)
Gämsen (Rupicapra rupicapra)
Von den steilen Hanglagen des Walgaus im Winter bis zu den höchsten Gipfeln des Rätikons im Sommer erstrecken sich die natürlichen Lebensräume vom Gamswild. Die widerstandsfähigen Hornträger werden bis zu zwanzig Jahre alt und erreichen ein Gewicht von bis zu 40 Kilogramm. Im Winter ist ihr Fell fast schwarz, im Sommer fahlgelb mit einem markanten dunklen Aalstrich am Rücken. Die Wiederkäuer ernähren sich von Gräsern, Kräutern, Blättern, Knospen und Trieben. Anders als ihr lateinischer Name Rupicapra Rupicapra (übersetzt: Felsenziege) vermuten lässt, zählt das Gamswild nicht zu den Ziegenartigen, sondern bildet eine eigene Gruppe unter den wildlebenden Hornträgern.